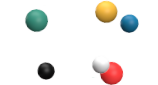Blood-powered climbing skills

The migratory salamander Aneides vagrans can quickly fill up, capture and drain the blood in the tips of its toes. This enables it to attach itself to surfaces, let go and optimize its locomotion. This was discovered by a team led by Dr. Christian Brown, postdoctoral researcher in integrative physiology and neuroscience at Washington State University (WSU). The discovery not only reveals a previously unknown physiological mechanism in salamanders, but also has implications for bionics-inspired designs. The findings about the mechanics of salamander toes could contribute to the development of adhesives, prosthetic limbs and even robotic appendages.

The findings on the mechanics of salamander toes could contribute to the development of adhesives, prostheses and even robotic appendages.
“Gecko-inspired adhesives already allow surfaces to be reused without losing their stickiness,” says Christian Brown. Understanding salamander toes could lead to similar breakthroughs in attachment technologies.
Salamanders of the genus Aneides, with their square-shaped toe tips and bright red “blood lakes” visible just beneath their translucent skin, have long puzzled biologists. It was believed that these features promoted oxygenation. But there was no evidence for this.

Browns Interesse an dem Thema geht auf eine unerwartete Beobachtung während der Dreharbeiten zum Dokumentarfilm „The Americas“ zurück.
Browns Interesse an dem Thema geht auf eine unerwartete Beobachtung während der Dreharbeiten zum Dokumentarfilm „The Americas“ zurück. Während er als Salamander-Experte am Set assistierte, hatte er die Gelegenheit, durch die leistungsstarken Kameraobjektive des Produktionsteams zu beobachten, wie sich die Amphibien fortbewegen. Dabei fiel ihm etwas Merkwürdiges auf: In die durchsichtigen Zehenspitzen der kleinen Kreaturen strömte Blut kurz bevor sie einen Schritt machten. Brown und Kameraassistent William Goldenberg beobachteten das Phänomen wiederholt. „Wir sahen uns an und fragten: „Hast du das gesehen?'“, sagte Brown.
Nach den Dreharbeiten fragte Brown den Kameramann, ob er daran interessiert sei, seine Filmausrüstung zu benutzen, um das, was sie beobachtet hatten, auf wissenschaftliche Basis zu stellen. Durch hochauflösende Videoversuche entdeckte das Team, dass wandernde Salamander den Blutfluss zu jeder Seite ihrer Zehenspitzen fein kontrollieren und regulieren. Dadurch können sie den Druck asymmetrisch anpassen, was den Halt auf unregelmäßigen Oberflächen wie Baumrinde verbessert. Überraschenderweise scheint das Blut, das vor dem Ablösen der Zehen einströmt, den Salamandern eher beim Ablösen als beim Festhalten zu helfen. Indem sie die Zehenspitze leicht aufblähen, verkleinern die Salamander die Kontaktfläche mit der Oberfläche, auf der sie sich befinden, und minimieren so die zum Loslassen erforderliche Energie. Diese Geschicklichkeit ist entscheidend, um sich auf den unebenen und rutschigen Oberflächen der Baumkronen zurechtzufinden und um beim Fallschirmspringen zwischen den Ästen sicher zu landen.
Erkenntnisse könnten über Aneides vagrans hinausgehen. Ähnliche durchblutete Strukturen finden sich auch bei anderen Salamander-Arten, einschließlich aquatischer Arten, was auf einen universellen Mechanismus zur Regulierung der Zehensteifigkeit hindeutet.
Original publication:
Christian E. Brown et al.
Vascular and Osteological Morphology of Expanded Digit Tips Suggests Specialization in the Wandering Salamander (Aneides vagrans)
08 January 2025
Journal of Morphology, Volume286, Issue1